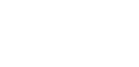Die Stahlindustrie in Deutschland fordert von der Bundesregierung entschlossenes Handeln, um die Zukunft der Branche und damit auch die industrielle Wertschöpfung im Land zu sichern.
Beim Stahldialog in Berlin am 6.11.2025 warnten Branchenvertreter eindringlich vor den wachsenden Herausforderungen, die die deutsche Stahlindustrie zunehmend unter Druck setzen. Besonders die wachsenden globalen Überkapazitäten, hohe Energiepreise und ungleiche Wettbewerbsbedingungen gefährden die Wettbewerbsfähigkeit und das Fortbestehen der Stahlproduktion in Deutschland.
„Die Stahlindustrie ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Es geht nicht nur um eine Branche, sondern um die Frage, wie wir industrielle Wertschöpfung in Deutschland langfristig sichern können“, erklärte Gunnar Groebler, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl. „Wir müssen uns fragen, ob wir die industrielle Basis des Landes aus eigener Stärke heraus erhalten wollen oder ob wir uns zunehmend von internationalen Importen abhängig machen“, fügte Groebler hinzu.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Nach Berechnungen des EY-Industriebarometers gehen monatlich rund 10.000 Industriearbeitsplätze in Deutschland verloren. Besonders betroffen sind dabei Regionen, die stark industriell geprägt sind. In diesen Gebieten spüren die Menschen eine zunehmende Verunsicherung und Zukunftsangst. „Wer den sozialen Frieden sichern will, muss die industrielle Grundlage dieses Landes sichern“, so Groebler weiter.
Die Stahlindustrie in Deutschland zählt zu den größten in Europa: Mit 37,2 Millionen Tonnen Jahresproduktion ist Deutschland der führende Stahlproduzent auf dem Kontinent. Rund 5,5 Millionen Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt an stahlintensiven Wertschöpfungsketten. Der Werkstoff Stahl ist dabei von zentraler Bedeutung für zahlreiche Schlüsselindustrien wie den Maschinenbau, die Automobilproduktion, den Schienen- und Straßenbau, die Energieversorgung – einschließlich Windkraftanlagen – sowie die Verteidigungsindustrie. „Stahl ist kein Material wie jedes andere. Er ist eine strategische Ressource“, sagte Kerstin Maria Rippel, Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl.
Trotz der Herausforderungen zeigt sich die Stahlindustrie bereit, Verantwortung für ihre eigene Zukunft zu übernehmen. Unternehmen investieren bereits massiv in die Transformation der Branche, etwa durch den Aufbau von Direktreduktionsanlagen, die Umstellung auf grünen Wasserstoff und die Entwicklung CO2-reduzierter Stähle. Groebler unterstrich: „Wir übernehmen Verantwortung – ökologisch, ökonomisch und sozial. Aber Verantwortung braucht ein Gegenüber. Jetzt ist die Politik am Zug.“
Vier Handlungsfelder für die Bundesregierung
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl hat in einem Appell an die Bundesregierung vier zentrale Forderungen formuliert, um die Stahlindustrie für die Zukunft zu rüsten:
Fairer Wettbewerb und Schutz vor Marktverzerrungen
Die Stahlindustrie fordert einen robusten Handelsschutz gegen Preisdumping und Überkapazitäten, insbesondere aus Ländern, die intransparent subventionierte Stahlproduktion betreiben. Dies umfasst auch die Schließung bestehender Lücken im CO2-Grenzausgleichmechanismus (CBAM), um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.
Wettbewerbsfähige Energiepreise
Die Stahlbranche fordert eine dauerhafte Senkung der Netzentgelte sowie die Fortführung und Vertiefung der Strompreiskompensation. Langfristig wird die Einführung eines Industriestrompreises als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland angesehen.
Beschleunigung des Aufbaus der Wasserstoffwirtschaft
Die Stahlindustrie sieht im Wasserstoff eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft. Besonders wichtig sei ein schneller Ausbau eines europäischen Wasserstoffnetzes, die Einführung von Risikobürgschaften für langfristige Verträge und wettbewerbsfähige Preise für Wasserstoff im Produktionshochlauf.
Stärkung der Nachfrage nach emissionsarmem Stahl
Die Branche fordert von der Politik, die Nachfrage nach CO2-reduziertem Stahl zu fördern, etwa durch eine Vorbildfunktion bei öffentlichen Beschaffungen. Auch Anreizsysteme, etwa bei der Anrechnung von CO2-reduziertem Stahl auf Flottengrenzwerte, könnten die Nachfrage stärken und den CO2-Footprint von Abnehmerbranchen verringern.
Industriepolitik ist Souveränitätspolitik
Die Wirtschaftsvereinigung Stahl warnt in diesem Zusammenhang, dass eine fortschreitende Deindustrialisierung Europas nicht nur ökonomische, sondern auch strategische Folgen hätte. „Wenn wir industrielle Wertschöpfung verlieren, verlieren wir auch wirtschaftliche Gestaltungskraft, technologische Führung und schließlich politische Handlungsfähigkeit“, erklärte Groebler. „Es geht nicht nur um den Erhalt von Arbeitsplätzen oder den Schutz vor unlauteren Wettbewerbspraktiken, sondern um die Frage, wie wir unsere wirtschaftliche Zukunft selbst gestalten.“
„Wir sind bereit, den Wandel aktiv mitzugestalten“, so Rippel abschließend. „Jetzt braucht es das entschlossene Handeln der Bundesregierung, um die industrielle Zukunft Deutschlands zu sichern.“